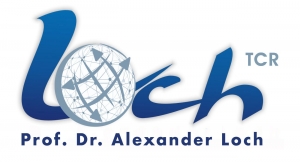Laufende Projekte
Kommunale Interkulturelle Kompetenzen Stärken (KIKS) (2022–2025)
→ in Kooperation mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg
Das Projekt „Kommunale Interkulturelle Kompetenzen stärken“ (KIKS) ist als ethno-psychologisch fundiertes Action-Research-Vorhaben konzipiert. Es verfolgt das Ziel, partizipativ eine vertiefte Auseinandersetzung mit eigenen und fremden (Verwaltungs-)Kulturen zu ermöglichen. Im Zentrum stehen Multiplikator:innen und sogenannte High Potentials – insbesondere Inspektorenanwärter:innen des Studiengangs Public Management sowie ausgewählte Drittstaatsangehörige. Diese Gruppen nehmen regelmäßig anjoint learning journeys teil, in deren Rahmen sie sich gemeinsam interkulturellen Lernprozessen widmen. Im Anschluss agieren sie als sogenannte „Behörden-Guides“ in Baden-Württemberg, indem sie bei interkulturellen Konflikten mediieren, niedrigschwellige Erstberatungen anbieten und Wege für ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen aufzeigen.
Die methodische Grundlage des Projekts bildet die Implementierung einer Serie interkultureller Premium-Dialogformate (joint learning journeys), an denen sowohl internationale/geflüchtete als auch deutsche Teilnehmende beteiligt sind. In diesen Formaten wird neues interkulturelles Wissen generiert und vertieft. Die qualitative Methodik orientiert sich an der Fokusgruppenarbeit, verzichtet jedoch auf standardisierte Stimuli oder vorgegebene Kulturdimensionen. Stattdessen stehen die lebensweltlichen Erfahrungen der beteiligten Akteure im Mittelpunkt.
Zwischen 2016 und 2025 nahmen an dem Projekt neben deutschen Studierenden und Mitarbeitenden von Ausländerbehörden auch Personen aus Syrien, Afghanistan, Iran, der Türkei, Guinea, Brasilien, Usbekistan, Nordafrika, Tibet, Indonesien und der Ukraine teil. Eine begleitende Studie mit dem Arbeitstitel „Best Practice in the Länd“ zu interkulturellen Erfolgsmodellen erscheint Ende 2025.
Perawat@Jerman: Die Migration indonesischer Pflegekräfte ins deutsche Gesundheitssystem (2023–2026)
→ in Kooperation mit indonesischen Akademikerinnen und Pflegefachkräften in Deutschland, gefördert durch die Baden-Württemberg-Stiftung (BWS+)
Im Jahr 2021 unterzeichneten die deutsche Bundesagentur für Arbeit (BA) und die indonesische Regierung (KemenP2MI) eine Vermittlungsvereinbarung, die es künftig in Indonesien ausgebildeten Pflegefachkräften („perawat“) ermöglicht, im deutschen Gesundheitssektor tätig zu werden. Die Teilnehmenden erwerben im Herkunftsland Deutschkenntnisse bis zum Niveau B1, werden interkulturell auf das Leben und Arbeiten in Deutschland vorbereitet und können nach einer möglichen Rückkehr – entsprechend dem Konzept des „Triple Win“ – neu erworbene Kompetenzen und Wissen in ihr Heimatland transferieren. In den vergangenen Jahren ist die Zahl indonesischer Pflegefachkräfte in Deutschland kontinuierlich gestiegen, was eine einzigartige Gelegenheit bietet, den gesamten Migrationszyklus – von der Psychogenese der Ausreiseentscheidung über Vorbereitung, Akkulturation, Integration, Arbeitszufriedenheit und interkulturelle Konflikte bis hin zu zirkulärer Migration, Reintegration und entwicklungspolitischen (Neben-)Wirkungen – umfassend zu erfassen.
Das Projekt PERAWAT@JERMAN (P@J) untersucht im Rahmen eines multimethodischen Langzeitdesigns die Migration indonesischer Pflegekräfte nach Deutschland vor dem Hintergrund der internationalen Debatte zu „Migration & Entwicklung“. Ziel des Vorhabens ist es, die Perspektiven der migrierenden Pflegekräfte differenziert zu analysieren und daraus evidenzbasierte Empfehlungen für die Entwicklung einer fairen und nachhaltigen Migrationspolitik abzuleiten.
Megathemen im deutsch-indonesischen Vergleich (2022–2025)
→in Kooperation mit der Universitas Indonesia (UI), gefördert durch die Baden-Württemberg-Stiftung (BWS+)
Es gibt zukunftsrelevante Themen, die weltweit von existenzieller Bedeutung sind und entsprechend in Wissenschaft und Politik intensiv diskutiert werden. Zu diesen Megatrends/Megathemen zählen unter anderem Klimawandel, Digitalisierung, Migration, Urbanisierung, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit sowie die Zukunft von Arbeit und Mobilität (vgl. OECD Strategic Foresight 2035).
Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF) und der Universitas Indonesia (UI) verfolgt das Projekt „Megathemen im deutsch-indonesischen Vergleich“ das Ziel, deutschen und indonesischen Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Plattform für einen vertieften, kultur- und systemvergleichenden Dialog zu ausgewählten Megathemen zu bieten. Im Fokus stehen dabei unter anderem Best-Practice-Beispiele wie der European Green Deal, die Smart City Jakarta oder die europäische Regulierung von künstlicher Intelligenz.
Ein interdisziplinärer Sammelband, der Beiträge aus mehreren >Joint Learning Journeys und internationalen Summer Schools zu diesen Themen vereint, befindet sich derzeit in Vorbereitung.
AKTUELLE THEMEN
Human Capacity Development, Migration Governance, Wertebildung, Zuwanderung & Integration, Cross-Cultural Management, Perspektivwechsel, Wirkungsmonitoring, interkulturelle Didaktik.
MITARBEIT IN
FORSCHUNGSVERBÜNDEN
→ Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen
→ Netzwerk Fluchtforschung
→ Researchgate
→ Publikationen
ABGESCHLOSSENE PROJEKTE
Human Capacity Development for Migration Governance (2020)
Der Global Compact on Refugees (GCR) sowie der Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM) stellen internationale Organisationen (wie beispielsweise UNHCR, IOM, Weltbank) und nationale Entscheidungsträger vor zahlreiche neue Herausforderungen. In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) geht das Forschungsprojekt Human Capacity Development for Migration Governance (HCD4MG) der Frage nach, wie in ausgewählten Ländern individuelle und organisationale Kapazitäten aufgebaut werden (können), um einen sog. „tripple-win effect“ (für Herkunftsländer, Aufnahmeländer und Schutzsuchende) zu erzielen und damit idealerweise auch zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen beizutragen. Zentral ist hierbei das Konzept der (multi-level) „Migration Governance“, worunter zumeist Prozesse verstanden werden, bei denen Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Geflüchtete, Migranten und andere interdependente Akteure für das Regierungshandeln involviert werden, um kohärente „migration policies“ zu entwickeln ‑ und zu implementieren. Die Analyse von Trainings-Skripten, die teilnehmende Beobachtung in Capacity Development Maßnahmen und die systematische Befragung von Schlüsselakteuren in diesem Kontext zeigt gegenwärtig, dass vieles repliziert wird, was aus der Beratungsarbeit mit Ministerien, Ländern und Kommunen längst zur etablierten best practice der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zählt; Innovationen (beispielsweise zum Remittances-Management, ICT4refugees, the-future-of-work) gehen jedoch gerade von Ländern wie Indonesien, Ecuador, Kosovo und dem Global Forum on Migration and Development (GFMD) aus.
Wertevermittlung in der Bonner Jugendhilfe (2019–2020)
Knapp 30% der Menschen in Nordrhein-Westfalen haben einen so genannten ”Migrationshintergrund”.
Anfang 2019 lebten in Deutschland 41.211 unbegleitete minderjährige Geflüchtete in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit.
Wenn auch ihre absolute Zahl seit Ende 2016 kontinuierlich abnimmt, so nehmen nach einer Phase der Erstversorgung die sozialpädagogischen, psychologischen und jugendhilfe-rechtlichen Erfahrungen und Fragestellungen, die sich um „Integration“ und „interkulturelle Konflikte“ beim Zusammenleben von über 40 Nationen drehen, zu.
Die Auseinandersetzung mit Werten und Normen innerhalb der deutschen Gesellschaft als auch mit den kulturellen Sichtweisen von Jugendlichen aus verschiedenen Herkunftsländern ist der Ausgangspunkt dieser Studie; Überlegungen zur ”Wertebildung” (was tiefsinniger als die reine ”Vermittlung” von Normen und Werten ist) werden partizipativ mit den Schlüsselakteuren der Jugendhilfe entwickelt und mit der interdisziplinären Werteforschung im deutschsprachigen Raum in Austausch gebracht.
Action Research Projekte
Interkulturelle Perspektivwechsel von Studierenden und Geflüchteten: Schwarzwald (2017, 2018, 2019)
Fladenbrot oder Maultaschen? Die Aushandlungsprozesse von Studierenden der Verwaltungswissenschaften und Geflüchteten aus Syrien und zahlreichen anderen Herkunftsländern, die in Deutschland bereits A2-Sprachniveau erreichten und gemeinsam in einer Schwarzwaldhütte in einen vertieften Dialog über Kultur, Integration, Widerstand, Flucht, De-Christianisierung des Abendlandes, Modernisierung der Islam, Kulturstandards etc. treten, sind angewandte Forschung par excellence.
Lehrmittelentwicklung am Instituto Cathólico para Formação de Professores in Baucau: Osttimor (2002–2005)
Ethnologen neigten längste Zeit dazu, über die Fremden zu forschen, statt mit den Menschen anderer Kulturen in einen Dialog zu treten, der gegenseitig inspiriert und Entwicklungsprozesse anstößt. In Osttimor bot sich nach der Unabhängigkeit des Landes die Möglichkeit, zusammen mit jungen lokalen Forschern nicht nur einzigartiges ethnographisches Material (z.B. über die Sakralhaus-Rekonstruktionen der Makassae) zu entdecken und die postkonfliktuösen Prozesse in Asiens least developed country (LCD) zu beobachten, sondern durch den Aufbau eines Lehrer-Ausbildungsinstituts (ICFP) einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung des Bildungswesen dieses Landes zu leisten.
Film-Produktionen zur interkulturellen Kommunikation in Chiang Mai, Thailand (1999)
Im VOP-Studio, Chiang Mai, entstanden zahlreiche Filme zu typischen Critical Incidents in der Zusammenarbeit asiatischer und deutscher Kooperationspartner. Spätere Filmaufnahmen zur Interkulturellen Kommunikation in afrikanischen, orientalischen und südamerikanischen Kontexten folgten in der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung.
Mit Schiffen, Bussen & Transsibirischer Eisenbahn vom Rand Südostasiens nach Paris
Umwege erhöhen bekanntlich die Ortskenntnis. Und wer sein Ziel schnell erreichen will, sollte – so rät Konfuzius – langsam gehen. Nach drei Jahren im insularen Südostasien erfolgte die Widerannäherung an Deutschland anno 2005 langsam via Indonesien, Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, China, Mongolei, Russland, Ost-Europa. Doch der Re-Entry-Shock angesichts der Euro-Einführung während längerer Abwesenheit blieb trotzdem nicht aus …